Bayer 04 Leverkusen vs. 1899 Hoffenheim
Camus und Gluck – „Come on“
Eine ganz und gar nicht absurde Ouvertüre
– mit intellektuellem Interludium
Wir verweisen ja gerne darauf, dass wir uns als Camus‘ Erben verstehen dergestalt, dass wir uns in der Tradition des selbstdarstellenden Satzes des Autors von Werken wie „Die Pest“, „Licht und Schatten“, „Das Missverständnis“, „Die Gerechten“, „Der Mensch in der Revolte“ sowie „Der Mythos des Sisyphos“ sehen.
„Alles, was ich im Leben über Moral oder Verpflichtungen des Menschen gelernt habe, verdanke ich dem Fußball.“
Während erstgenanntes Werk dir, geneigte/r Leser/in vielleicht noch aus dem Französisch-Unterricht in der Schule bekannt ist, ist das bei letztgenanntem Werk eher nicht der Fall. „Der Mythos des Sisyphos“ ist, laut Unterzeile, ein „Versuch über das Absurde.“
Das Absurde ist der zentrale Begriff seiner Philosophie – und hat nichts mit Humor, aber auch einiges mit Fußball zu tun, denn für Camus entsteht das Absurde aus der Gegenüberstellung der berechtigten Sinnsuche des Menschen und der Sinnlosigkeit der Welt. Und gerade der Fußballfans kennt das:
- „Was ist denn das jetzt schon wieder?“
- „Warum tu ich mir das an?“
- „Dieselbe Scheiße wie im letzten Jahr.“
Und schon sind wir mitten im Spiel gegen beim Deutschen Meister 2023/24 und amtierenden Vizemeister – genauer in der Anfangsphase: 1. Ball auf unser Tor – und drin.
Nach einem Standard und trotz dichter Strafraumbesetzung kommt ein gegnerischer Stürmer, weil einer der Verteidiger nicht konsequent mitläuft und ein anderer falsch, also hinter dem Mann, steht, mit seinem Schädel an die Kugel, die er dann recht frei einnetzen kann.
Doch damit mit den Parallelen nicht genug. Zuvor hatten wir die Chance zur Führung, vergeigten diese aber. Lemperle traf nur den Pfosten.
Sieben Minuten gespielt und schon war sie da wieder … wie in den letzten Jahren auch … die Erinnerung an die Vorsaison. Es war im besten Camus’schen Sinne, nicht zu verwechseln mit dem, wie Ionesco den Begriff verstand, absurd.
Für Camus besteht das Absurde im Erkennen der Tatsache, dass das menschliche Streben nach Sinn in einer sinnleeren Welt notwendigerweise vergeblich, aber nicht ohne Hoffnung bleiben muss. Vorausgesetzt, er kämpft dagegen an. Vorausgesetzt, er resigniert nicht, verfällt nicht in Passivität, sondern entwickelt auf sich allein gestellt selbstbestimmt ein Bewusstsein neuer Möglichkeiten der Schicksalsüberwindung, der Auflehnung, des Widerspruchs und der inneren Revolte.
Um dies ins modern Unakademische zu übersetzen…
Dies ist der feine Unterschied in der Ättitjuud zwischen „Fuck!“ und „Fuck you!“
An dieser Stelle könnte man nun Ionesco ins Spiel bringen, aber das könnte zum jetzigen Zeitpunkt zu weiteren Irritationen führen. Schließlich haben wir so viele neue Spieler im Kader, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wer denkt, dies sei einer der neuen. Ist er nicht.
Eugène Ionesco war wie Camus ebenfalls Franzose und Schriftsteller, der aber weniger für seine Romane und Essays bekannt wurde denn für seine Theaterstücke, die das Absurde durch sinnlose Dialoge, charakterlose Marionettenfiguren, nichtlineare Handlungen und dem Verlust der Funktion der Sprache kennzeichneten.
Und hier merkt man schon den Bruch zur Vorsaison. Vielleicht könnte man gar von der Anti-Absurdität sprechen, denn nach dem Rückstand gab es einiges zu sehen, aber charakterlose Marionettenfiguren und nichtlineare Handlungen waren nicht dabei. Ganz im Gegenteil.
Unsere Jungs kickten einfach weiter. Mehr noch, sie spielten weiter. Weiter direkt, weiter schnell, weiter steil, weiter nach vorn, wo sie dann auch pressten, wenn sie das Spielgerät verloren.
Gleichzeitig waren wir auch defensiv recht stabil, was wir auch sein mussten, denn die Gastgeber spiegelten unsere Spielweise bis auf das hohe Pressing, aber auch sie waren sehr direkt, sehr ballsicher und hatten eine Spielanlage, die ganz klar auf einstudierte Passfolgen basierte, wie man es sonst eher aus dem Basketball oder Handball kennt. Und wie bei diesen Sportarten schien es in diesem Spiel fast so, als ob es auch im Fußball die Regel gäbe, dass, ist der Ball erstmal über der Mittellinie, darf er nicht mehr zurückgespielt werden. Das war schon sehr anschaulich und insbesondere insofern höchst bemerkbar, als dass beide Mannschaften mit den Mannschaften der letzten Spielzeit(en) personell kaum etwas zu tun hatten.
Das Manko bei beiden Teams war der Abschluss. Trotz optisch gefälligen Spiels gab es de facto eher wenig Schüsse aufs Tor, was wiederum für die Defensivarbeit beider Mannschaften sprach. Dabei hatten die Gastgeber das Glück, dass der Schiedsrichter von unseren Spielern geführte Zweikämpfe meist als regelwidrig ansah, was zu einigen ruhenden Bällen in der Nähe unseres Strafraums führte – und diese wiederum zu Unruhe.
Zweimal rettete Oli Baumann sensationell und bewahrte die TSG vor einem größeren bzw. erneuten Rückstand, denn in der Zwischenzeit glichen wir aus. Einmal klappte es, dass wir mit einer Passfolge bis an den Fünfer kamen und dort dann aber nicht noch einmal „in den Rücken der Abwehr“ spielten, sondern sie ins Herz trafen, sprich: ins Netz. Asllani. 1:1.
Halbzeit. Pause. Zeit zur Reflexion. Was haben wir da gesehen? Was war daran Camus? Was Ionescu? Einiges.
Die Mannschaft beherzigte Camus‘ Ansatz der Eigenaktivität als einzig probates Mittel der Sinnsuche des Menschen gegen die/in der Sinnlosigkeit der Welt, gleichzeitig war da aber Ionesco zu entdecken.
„Nur im Einklang mit sich selber kann man sich tatsächlich entwickeln.“
Und das hat wenig bis nichts mit „absurd“ im eigentlichen Sinne zu tun, denn der Ursprung des Wortes (lat. „absurdus“) bedeutet so viel wie „misstönend“, „verstimmt“, obwohl das eigentlich absurd ist, denn die Wortbestandteile geben das so nicht her, schließlich bedeutet das Präfix „ab-“ soviel wie „weg von“ und „surdus“ „taub“, „dumpf“. Also warum die Römer akustische Dissonanzen mit „weg von dumpf“ beschrieben, deucht Deutschen wenig einleuchtend.
Andererseits gibt es auch bei uns das Wort „Untiefe“ in der Bedeutung „besonders weit hinabreichender Abgrund“, obwohl es ja eigentlich nach seinen Wortbestandteilen ausschließlich „flach“ bedeutet, was es auch tun kann. Aber das führte jetzt zu Januswörtern und die hatten wir hier schon – und hier.
Wie bitte? Warum wir nicht einfach weiter über das Spiel berichten können statt so blöd pseudoklug daherzuschwadronieren, tönt es da klassisch absurd?
Nun, erstens ist gerade Halbzeit, zweitens hätten wir uns nicht nur als Camus‘, sondern auch Wums Erben sehen können, und das nicht nur, weil wir bunte Hunde sind, sondern weil schon er wusste, wie dieser Dialog mit Wim Thoelke selig darlegt:
Fußball ist ein Spiel für Intellektuelle
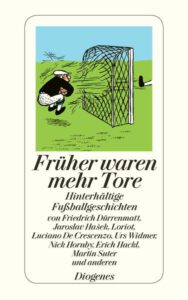 Wum: Ich habe einige wichtige Fragen…
Wum: Ich habe einige wichtige Fragen…
Wim: Na, dann schieß los… nein, nein… ich meine: Nun frag schon!
Wieviele Männer gehören eigentlich zu einer Fußballmannschaft?
Elf.
Und wieviel Bälle haben die?
Einen.
Einen? Das ist ja wahnsinnig unergiebig!
Du, die haben aber ‘ne Menge zu tun! Die müssen doch den Ball ins Tor bringen!
Na und?
Na, da stehen doch die anderen davor…
Welche anderen?
Die anderen elf.
Haben die auch ’n Ball?
Nein!
Aber womit spielen die denn? Das ist doch alles völlig sinnlos?
Nein, nein, die müssen doch auch den Ball ins Tor schießen.
Wieso? Ich denke, die haben keinen Ball?
Das ist doch derselbe, Mensch!!
Derselbe Mensch?
Derselbe Ball!
Na, 22 erwachsene Männer werden doch wohl einen lumpigen Ball in dieses blöde Tor schießen können?
In zwei, Wum, in zwei Tore!
Aber man kann doch einen Ball nicht gleichzeitig in zwei Tore schießen!
Nein, nein, die anderen wollen ja auch nur, dass der Ball ins andere Tor geht!
Und wissen die einen, dass die anderen den Ball in das eine andere Tor schießen wollen, während die anderen vermuten, dass die einen den Ball im anderen Tor benötigen?
So ist es!
Siehst Du, das ist wieder so ein kompliziertes Spiel für Intellektuelle!
(Quelle)
Oder auch nicht. Per se. Denn just aus der epistemisch irritierenden Simplizität emergiert die Komplexität des Spiels, dessen Kunst in ihrer Reduktion besteht, um die teleologische Verdichtung polykinetischer Emergenzen in eine singuläre, toräquivalente Finalmanifestation zu sublimieren. Und just dies demonstrierte die TSG zu Beginn von Durchgang 2.
Was zuerst wie ein Rückfall in alte Spielweise schien – durch langsames Rückpassspiel bin zuletzt zum Schlussmann – führte zum Rückstand der Gastgeber, da Baumann den Ball sehr weit in die Spitze drosch, wo Asllani vor allem seinen Rücken einsetzte, um den Ball zu behaupten. Lemperle übernahm a) den Ball, b) Verantwortung und c) sich nicht. Da behaupte noch wer „immer dieselbe Scheiße“, denn obgleich es wieder just Lemperle war, der den ersten Schuss des Durchgangs aufs gegnerische Tor abgab, justierte dieser diesmal den Ball besser, so dass dieser zwar wieder in Richtung Pfosten unterwegs war, diesmal aber knapp daneben ging – auf der für uns richtigen Seite davon. Drin. Spiel gedreht. 2:1.
Viel einfacher kann man es nicht spielen, aber gerade das Einfache macht es ja so schwierig, wie just vor zwei Absätzen dargelegt.
Das Schwierige war fortan, diese Führung über die Zeit zu bringen. Nicht, weil der Vizemeister alles nach vorne warf, sondern vielmehr mehr und mehr Spieler von uns am Boden lagen.
Musste schon Machida kurz vor Ende der 1. Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, konnten auch Hranac und Coufal aufgrund muskulärer Probleme nicht mehr weiterspielen. Das heißt: Unsere ohnehin neue Defensive musste während des Spiels fast runderneuert werden. Und doch änderte sich wenig. Die offensiven Aktionen ließen zwar deutlich nach, aber die defensive Stabilität, was in der Vorsaison ein Oxymoron gewesen wäre („eckiger Kreis“), blieb, was in der Vorsaison nie der Fall war, erhalten. Auch wenn die TSG in der 2. Halbzeit nur einen Schuss aufs Tor des Vizemeisters abgab (s. o.), sie ließ auch nur einen gefährlichen Schuss aufs eigene Tor zu.
Das 1. Ligaspiel, der 1. Ligasieg. Ein Grund zur Freude …
Hinweis:
Das war’s zum Spiel. Jetzt kommt die Musik ins Spiel.
Schließlich war das das Auftaktspiel …
… und Anlass zur Fundierung unserer These, dass dies wider Erwarten eine sensationelle Saison werden könnte.
Griffen wir hierfür in der letzten Woche wettbewerbsimmanent auf die Ergebnisse der Erstrundenpartien der Jahre seit dem Aufstieg in die DFL zurück, möchten wir hier unserem Wesen entsprechend und ganz im Sinne Camus‘ auf das Tiefste zurückgreifen, das die Menschen miteinander verbindet (wenn überhaupt): die Kultur – und das getreu dem an Ionescos Zitat (s.o) erinnernden Motto, dass nur wer sich ändert, sich selbst treu bleibt, bzw:
„Nur in der Dynamik der steten Transformation erweist sich Kontinuität.“
Das war also das Auftaktspiel eines sehr langen Werkes (Saison). In der Musik ist das lange Werk die Oper und da gibt es die Ouverture. Diese hat sich aber über die Jahrhunderte sehr verändert, wobei es da auch nicht DIE Ouvertüre gibt. Es gibt verschiedenen Formen davon, aber wir denken, in diesem Spiel hatten wir Gluck –genauer: Christoph Willibald Ritter von Gluck (1714–1787) – als „Paten“
Heute ist er kaum noch wem bekannt, aber er war einer der zentralen Opernkomponisten des 18. Jahrhunderts, der durch seine Reformideen maßgeblich zur Entwicklung der Gattung beitrug. Eine zentrale Rolle in dieser Reform spielte die Behandlung der Ouvertüre. Insbesondere in dem Punkt war er ein großes Vorbild für Wolfgang Amadeus Mozart, der Glucks Fähigkeit bewunderte, Affekt und Dramatik über Virtuosität zu stellen. Man könnte auch sagen: Es ging ihm, Gluck, ums Gesamtwerk, den Gesamtkörper (Orchester und Gesang), nicht die Heraushebung eines Instruments, einer Stimme. (vgl. „Der Star ist die Mannschaft“, B. Vogts)
Vor Gluck gab es in älteren italienischen Opern meist eine von der Handlung unabhängige, dreisätzige Eröffnung – rasch, langsam, wieder rasch, die sinfonia genannt wurde. In der französischen Tradition war die Ouvertüre eine eher repräsentative, festliche Einleitung mit charakteristischem punktiertem Rhythmus. Gluck aber verstand die Ouvertüre zunehmend als dramatische Einleitung, die nicht (nur) das Publikum zur Ruhe bringen und Aufmerksamkeit erzeugen sollte, sondern auf den Charakter der Oper vorbereiten, emotionale Stimmungen andeuten und motivische Keime aus der späteren Handlung vorwegnehmen.
Mozart hielt sich zu Anfang in seinen italienischen Opern noch an die Idee der sinfonia, doch spätestens die Ouvertüre zu Don Giovanni spiegelt die enge Verbindung von Ouvertüre und Drama wieder. Und Zeitdruck, denn angeblich wurde die Ouvertüre zu diesem Werk erst am Morgen des Tages der Uraufführung fertig.
Da war die TSG schon schneller, besser vorbereitet. So sahen wir in dem Spiel (und auch in den Proben aka Vorbereitungsspielen) wesentliche Elemente der Gluck’schen Reformouvertüre.
- Vorbereitung auf den Charakter der Saison
Das Spiel der TSG wird offensiv defensiv ausgelegt sein. Es wird darumgehen, den Gegner so weit wie möglich vom eigenen Tor wegzuhalten. Daher sind keine Belagerungen des gegnerischen Sechzehners zu erwarten, dafür eine hohe Dichte in der gegnerischen Hälfte, um dessen Spielaufbau so gut es geht zu verunmöglichen. - Andeutung emotionaler Stimmungen
Das Team ist ein Team. Ob es Machidas Grätsche im DFB-Pokalspiel war oder Chaves‘ Säge, als er einen Abstoß erhielt oder die Umarmung Tourés durch Asslani, nachdem der Ivorer selbst aufs Tor geschossen hatte, statt den Ball auf ihn zu passen, zeigt eine fast schon vollkommene, gar ans Kitschige grenzende Harmonie – in TSG-Dur.
G-Dur steht für Frohsinn, Heiterkeit, Unschuld, Dankbarkeit, für die Nähe zum „einfachen Volk“, Tanz, Natur – und bietet doch genügend Strahlkraft für große, festliche Momente. - Vorwegnahme motivischer Keime der kommenden Handlung
Es wird Rückschläge geben – sei es durch Gegentore oder Verletzungen, aber es scheint für jede Situation eine taktische und/oder personelle Antwort zu geben.
Zugegeben, alles sehr früh – da wird noch viel auch im Akkord gearbeitet werden müssen, bis der letzte Akkord dieses Werkes Mitte Mai 2026 gespielt sein wird. Aber der Auftakt war schon mal grandios.
Da capo.
Oder in anderen Worten:
neudt.: „Come on!“



Submit a Comment