1899 Hoffenheim vs. FC Augsburg
Wunder und ihre Kinder
Ein nicht ganz talentfreier Beitrag mit viel Musik,
rektalen Bezügen und nachdenkenswerter Heiterkeit
„Um ernst zu sein, genügt Dummheit, während zur Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist.“
Dieser Satz wird Shakespeare zugeschrieben. Aber um den englischen Dichter soll es heute nicht gehen, schließlich hat der Barde aus Stratford-upon-Avon aber mal so gar nichts mit dem gestrigen Gegner zu tun. Aber ähnlich der kleinen, rund 150 Kilometer nordwestlich von London gelegenen Stadt in der Grafschaft Warwickshire hat die drittgrößte, rund 250 Kilometer südöstlich von Sinsheim gelegene Stadt Bayerns im Regierungsbezirk Schwaben einen ganz fest mit ihr verwobenen Namen eines ganz, ganz großen Künstlers der Weltgeschichte – und damit, liebe/r bildungsnahe/r Leser/in, sind die Fugger schon mal raus. 🙂
Wen also könnten wir sonst meinen? Doch nicht etwa unseren Sportdirektor? Nein, auch den nicht, auch wenn man schon zugeben muss, dass das, was er da Spielzeit für Spielzeit an Kader zusammenstellt, schon was von Kunst hat.
Tatsächlich ist Alexander Rosen ein Kind der Stadt, allerdings erblickte er dort erst 260 Jahre nach (Johann Georg) Leopold … na? na? na? … das Licht der Welt, weshalb sich Augsburg als einzige deutsche Stadt (die anderen beiden, die das dürfen, sind Wien und Salzburg) „Mozartstadt“ nennen darf.
„Leopold Mozart?“, fragst du. „Hieß der Mozart nicht ’Wolfgang Amadeus’?“
Nein. So hieß er nicht. Getauft wurde er auf den Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Und das bekanntlich in Salzburg, wohin es seinen Vater des Studiums wegen zog. Seinem Philosophiestudium ließ er, Leopold, das der Jurisprudenz folgen, welches er aber nicht abschloss, sondern sich seiner Liebe, der Musik, widmete. 1747 wurde er dort „Hof- und Cammer-Componist“. Im gleichen Jahr heiratete er im Salzburger Dom Anna Maria Pertl, mit der er sieben Kinder hatte, von denen fünf sehr früh verstarben – nur die 1751 Maria Anna Walburga Ignatia und eben jener, 1756 als letzter der sieben geborene Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus erreichten das Erwachsenenalter – und beide waren wahrlich Musikwunderkinder.
Vor allem sein Sohn tat es ihm an – und er ihm so manches, was heute jeden Kinderschützer auf den Plan rufen würde. Der Vater erkannte sehr früh das Riesentalent seines Sohnes und nutzte das gnadenlos zu seiner eigenen Profilierung gegenüber den Großen und Mächtigen aus, um sich im Lichte seines Talents Ansehen am Hofe zu verschaffen. Ups, pardon, offiziell heißt das, wie auch heute noch bei den überehrgeizigen Eltern, die sich über die Noten ihrer Kinder definieren: förderte ihn.
Dieser „Förderer“ also zog mit seinem Filius herum und ließ ihn seine Kunststücke vorführen – und wer sich mit Psychologie auch nur ein bisschen auskennt, und gerade die Beziehung der beiden zueinander ist diesbezüglich hinreichend intensiv beschrieben, hat eine Vorstellung, wohin das führt.
Als Wolfgang in die Pubertät kam, kam es zum Bruch. Und wenig verwunderlich wird der Bruch meist umso heftiger, je intensiver zuvor die „Förderung“ war.
(Zur Abnabelung der Kinder von der sie die ersten eineinhalb Dekaden ihres Lebens dominierende Autorität wird auch gerne der Freud’sche Begriff vom (allegorisch zu verstehenden) „Vatermord“ verwandt. Ist aber falsch, da Freud diesen Begriff im Zusammenhang mit Religion verwandte. Damit ist Wolfgang auch nicht einmal metaphorisch gesehen ein „Vatermörder“, denn ein „Vatermörder“ ist, wenn nicht wirklich der Killer seines Erzeugers, ein steifer, vorne offener, hoher Stehkragen eines Herrenoberhemdes.)
Nun war Leopold, der gewiss einen Vatermörder getragen hätte, wäre der nicht erst im Biedermeier in Mode gekommen, ein sehr gestrenger und ernster Mensch . Sein Sohn mutierte zum Gegenteil, wovon jener Film hinreichend Zeugnis ablegt, der so heißt, wie es Wolfgang offiziell nie tat: Amadeus.
Er, Wolfgangus, machte sich gerne über alles und jeden lustig, auch über sich selbst. So fand er die Namen, die ihm seinen Eltern gaben, positiv gesagt: primitiv, gemeint ist: affig, weshalb er begann, auch seinen Nachnamen zu latinisieren und seine Briefe mit „Mozartus“ zu unterschreiben.
Aber als Genie, das er war, wusste er, dass ein solcher Gag keine ewige Gültigkeit hat, weshalb er weiter mit seinen Namen spielte – und alle Althumanisten wissen nun, warum er „Amadeus“ heißt, denn der Name ist nichts anderes als die 1:1-Verwandlung vom Griechischen Theophilus ins Deutsche Gottlieb ins Lateinische – genau:– Amadeus. (Das sollte doch ganz hilfreich sein beim nächsten Pubquiz. – Er selbst verwandte am liebste die französische Variante Amadé.)
Sein Humor war gnadenlos. Er ließ die Menschen, die sich mit ihm messen wollten, gerne spüren, dass er ihnen weit an Talent überlegen war, was ihm selbstverständlich viele Neider brachte. Aber weil er eben so ein Genie war, ließ man ihm viel am Hofe durchgehen und ignorierte dort, so gut es ging, alles, was unpassend erschien, wie beispielsweise seine Eskapaden in den Gasthäusern und Spelunken, aber halt auch musikalische Werke, in denen er seine Kompositionskunst mit ihren, um es höfischer und höflicher auszudrücken: skatalogischen Libretti, sprich: vulgären Texten.
(Ein wunderbares Beispiel hierzu der oben integrierte Kanon für 6 Singstimmen in B-Dur, KV 231, in dem der Text, wie so oft in Opern, vor lauter Klang nicht zu verstehen ist. Das ist die Ironie dabei, die ja durch die sachliche Werkwiedergabe (KV) noch verstärkt wird. Dieses KV geht auf Ludwig (Alois Friedrich Ritter) von Köchel zurück, der sich Ende Mitte des 19. Jahrhunderts die Mühe machte, alle Werke Mozarts chronologisch zu ordnen – auch die unflätigen. 1862 erschien sein „Chronologisch-thematisches Verzeichniß sämmtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts“, kurz: Köchelverzeichnis.)
Darin findet sich auch unter dem Eintrag „231“ der Text für obiges Werk („Leck mich im Arsch“) sowie weitere Werke, in denen Rektum eine wichtige Rolle spielte, wie z. B.
– KV 233 (Wenn du aufmerksam warst, geneigte/r Leser/in, erkennst du, dass dies kurz im Anschluss verfasst wurde, weil die Anordnung eben chronologisch erfolgte): Kanon, diesmal für 3 Singstimmen, ebenfalls in B-Dur „Leck mir den Arsch fein recht schön sauber“. (Wahrscheinlich ist hier aber nur der Text von ihm.)
– KV 441b: Kanon zu zwei Stimmen „Beym Arsch ist’s finster“
– KV 559: Kanon F-Dur für 3 Singstimmen „Difficile lectu mihi mars (et jonicu difficile)“, was reiner Nonsens ist – ähnlich dem Satz „Siita us vilat e in isses aban et.“ (= „Sieht aus wie Latein, ist es aber nicht.“).
Diese sinnlos aneinandergereihten lateinischen Worte klingen, wenn gesungen nach „Leck du mich am Arsch“ bzw. dem italienischen Wort für „Hoden“, so dass dies in Kombination mit dem das Ganze tarnende „difficile“ die Bedeutung hat von „Es ist schwierig für dich, meinen Arsch und meine Eier zu lecken.“)
Allein die Nummerierung zeigt, dass dies ein Thema für Mozart war, das ihn sein ganzes und letztlich kurzes Leben war. Drei Jahre nach KV 559 war es zu Ende – und passend dazu sowie zu seiner ganzen Ironie war ja auch seine Totenmesse „Requiem in d-moll“ (KV 626) bekanntermaßen sein letztes Werk, das er nicht einmal selbst fertig stellen konnte.
Noch bekannter dürfte die Wertschätzung sein, die man ihm nach seinem Tode entgegenbrachte: Er wurde in einem „einfachen allgemeinen Grab“ bestattet – ohne Kreuz, ohne Namen, ohne Leichenzug, so dass niemand so genau weiß, wo (und wann) genau Mozart beerdigt wurde.
Das war auch egal, denn während die einen trauerten, konnten endlich all die wieder glänzen, die er allesamt überstrahlte, die er mit Hohn und Spott versah, die sich, so sehr sie sich mühten, zeit seines Lebens nicht mit ihm messen konnten. Sie maßen sich nun an, seine Nachfolger zu werden. Doch weder der im Film thematisierte Antonio Salieri oder der ihm als „Hofcompositeur“, der den gleichen Vornamen hatte wie sein Vater, Leopold Kozeluch, schafften es ins Rampenlicht. Er blieb auch posthum die Lichtgestalt schlechthin.
Mit vielen, vielen tausend weniger Lux ausgestattet könnte man vieles davon auf Julian Nagelsmann übertragen:
Auch von ihm sind rektal fokussierte Aussagen überliefert („Scheiß da nix, dann föit da nix“), hat ein sehr lockeres, witziges, zum Teil spöttisches Mundwerk – und sehr, sehr viele (noch schweigende) Neider – und ist sich seiner Qualität bewusst und hält damit wenig hinterm Berg, wenngleich er dies nicht mourinhoesk macht, dennoch: Seine Aussage zur Zielsetzung zum Anfang der Saison ließ erst aufhorchen und dann auch schon die ersten hämischen Kommentatoren zu Wort kommen, nachdem es sich bisher so anließ:
-3 | -2 || 2 | 15
-3 | -5 || 1 | 10
-6 | -7 || 1 | 11
-8 | -10 || 1 | 11
-6 | -8 || 1 | 9
-6 | -7 || 2 | 11
-6 | -5 || 6 | 13
-6 | -5 || 4 | 8
-6 | -2 || 2 | 8
-4 | +1 || 3 | 7
Aber jetzt? Stand jetzt? Muss man sagen: Ja, mit
-1 Punkten, +3 Toren, ihnen auf Platz 5, uns auf Platz 6
sind wir in der Tat Jäger der Bayern – und mehr noch: aller Bayern, denn wir sind fertig mit ihnen – für 2018.
Während wir das Saisoneröffnungsspiel gegen die Auswahl aus München dumm verloren haben, haben wir gegen die beiden anderen Vertreter aus diesem Bundesland, wenngleich auch etwas glücklich, gewonnen, wobei man den 3:1-Auswärtssieg in Nürnberg als glücklicher einschätzen muss, als den 2:1-Sieg gegen die Mannen aus der Stadt, in der nicht nur Mozart oder Alexander Rosen, sondern auch Julian Nagelsmann seinen Anfang nahm: Augsburg, womit vielleicht eines der längsten Intros in der Geschichte unserer Spielberichte ihr Ende findet.)
Alle Fußballwelt in Deutschland spricht von einem eher glücklichen Sieg gegen die nicht nur Fugger-, sondern eben auch Mozartstädter, was man aber gerne rustikal abwenden kann mit den einfachen Worten, die in Bayern auch Bewunderung ausdrücken:
„Leckt’s mi am Oarsch!“
Was war das für eine feine, reine, reife Leistung unserer Mannschaft keine 66 Stunden nach dem kräftezehrenden Champions League-Spiel in Lyon. Acht Mann aus der Startelf am Mittwoch begannen auch dieses Spiel …
(FunFact:
Im Top-Spiel standen bei den Bayern acht Spieler in der Startelf, die das gleichlautende Champions League-Finale 2013 (!) bestritten (Neuer, Boateng, Alaba, Martinez, Müller, Ribéry sowie Hummels und Lewandowski))
… – für den verletzten Grillitsch spielte Nordtveit, und die Mitte der Woche wenig überzeugenden Nuhu und Belfodil wurden durch Bittencourt und Szalai ersetzt.
Das war wichtig, das war richtig, in dem Spiel, von dem man davon ausgehen musste, dass es sehr kampfbetont werden würde, eine eingespielte und dem körperlichen Spiel nicht abgeneigte Truppe ins, äh: aufs Feld zu führen.
Ja, es gab kein Offensiv-Feuerwerk, aber warum auch? Vielmehr wurde Ballbesitzfußball gepflegt, der hauptsächlich dazu diente, den Gegner nicht zu Chancen kommen zu lassen. Außerdem konnte so unter Wettbewerbsbedingungen das Laktat aus den Schenkeln gelaufen werden. Zudem ließen die wenigen, aber doch ansehnlichen Chancen auf Besserung in der 2. Halbzeit hoffen, zumal von den Gästen selbst aber so was von gar keine Gefahr ausging.
Selbst wenn unser Team bisweilen so schwere Beine hatte, dass selbst Fünfmeterpässe zu verhungern drohten oder zum Teil sogar direkt beim Gegner landeten, vergaben diese jene ähnlich kläglich wie der Schiedrichter pfiff.
Ja, wir wissen, es gehört sich nicht, den Schiedsrichter zu kritisieren, zumal dies erst die dritte Partie des Mannes von der SG Blaues Wunder in der Fußball-Bundesliga war. Wäre er aus dem Basketball gekommen, hätte man die ein oder andere Entscheidung auch verstehen können, aber auch die hätte nicht erklärt, warum es einen Freistoß für die Gäste gab, wenn einer von ihnen nach einem Kontakt mit einem der unseren am Boden lag, während umgekehrt das konstant nicht der Fall war.
Zum Glück war da nichts Spielentscheidendes dabei, aber das war schon sehr dürftig, was der Mann selbst in einem an sich sehr fairen Spiel pfiff. Immerhin reagierte er in der einzigen hitzigen Szene zwischen Vogt und Caiuby sehr besonnen und beließ es bei einer Ermahnung, nachdem die beiden aneinandergeraten waren, wobei die Szene sich schon zuvor entspannte als der Gästetrainer Baum seine Coachingzone verließ, um sich zwischen die beiden Bäume zu stellen und sie zu trennen.
Kurz zuvor fiel der Ausgleich für die Gäste, nachdem eben jener Vogt wie auch Bicakcic und überhaupt die ganze Hintermannschaft der TSG einen völlig ungefährlichen Ball hat passieren lassen, was Finnbogason dann auch ausnutzte und zum 1:1 einnetzte – durch einen Heber über den auch heute wieder gut haltenden Baumann, der drei Minuten zuvor aber großes Glück hatte, als ein Schuss desselben Spielers an den Pfosten knallte, woraus sich dann aber eine Konterchance für die TSG ergab, die Joelinton hervorragend zu Ende spielte, indem er die komplette Rumpfabwehr der Gäste auf sich zog und dann im richtigen Moment den Ball quer auf Kramaric legte, der nur noch einschieben musste. (Ja, so zackig ging’s auch während des Spiels.)
Dieses lange, eher breite, weniger bewegte Spiel (musikalisch: larghetto meno mosso) wurde plötzlich munter mit Schwung vorgetragen (allegro con brio) und entwickelte sich zu einem lebhaften Spiel (vivace con spirito).
Scheinbar war das Laktat nun wirklich raus, denn nicht die Gäste, wir liefen – als Mannschaft fast fünf Kilometer mehr. Das war sehr beeindruckend, wie auch die Konzentration gerade in der Defensive im Laufe der Spielzeit nicht abnahm. Durch verschiedene Tempowechsel achtete das Team dabei auch darauf, dass es sich nicht völlig verausgabte, aber wenn es aussichtsreiche Umschaltsituationen gab, wurden sie genutzt.
Leider vergurkten wir sie dann meist final, aber ein Mal eben nicht. Da gelang es Szalai dann doch, den Ball aufs Tor zu bringen, den Abpraller verwandelte der keine 100 Sekunden zuvor eingewechselte Nelson zur erneuten Führung. Oder um es in den Worten des bekanntesten, eingangs schon zitierten Dichters seiner Heimat zu sagen:
Zauberer wissen ihre Zeit.
Es war wahrlich magisch, was der junge Mann in den wenigen Minuten, die er auf dem Platz stand, zustande brachte. Was für ein Talent! Und auch Joelinton. Was für eine Maschine! Ihm tat der Aufenthalt in der einen österreichischen Mozartstadt Wien sichtlich gut – und Gott sei Dank wurde er nicht noch ein Jahr, gar in die andere österreichische Mozartstadt zu deren RB verliehen.
Auch wenn uns unsere Talente zum Ende der Saison verlassen werden (Nagelsmann zum deutschen RB, Nelson (wohl) zurück ins Land Shakespeares) und sie am liebsten heute als morgen an die vielen Ex-Hoffenheimer erinnern, die sich bei ihrem neuen Verein nicht wirklich etablieren oder gar weiterentwickeln konnten (u.a.: Eduardo, Obasi, Ba, Gustavo, Beck, Compper, Volland, Toljan, Rudy, Uth, Wagner), freuen wir uns jetzt erst einmal, dass sie noch da sind und wir es nach einem nicht Fehl-, aber doch Quälstart in die Saison nun doch geschafft haben, nach diesem 2:1 oben und ganz nah dran an den Bayern zu sein.
Lasst uns also heiter bzw. – wie es im KV 231 auch heißt – froh: sein. Die Mannschaft tat gestern alles dafür, auch dass wir des Werkes Titel im bayerischen Sinne auch bewundernd meinen – und für den Fall, dass Shakespeare Recht hat, hoffen wir unseren Teil zur Stärkung der hierfür notwendigen Unerlässlichkeit beigetragen zu haben. In aller Bescheidenheit, versteht sich …
Aber jetzt erstmal:
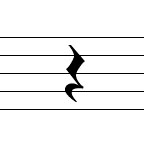
P.S.: Wer KV 231, Kanon für 6 Singstimmen: Leck mich im Arsch von Wolfgang Amadeus Mozart nachspielen möchte, hier haben wir die Partitur zum Download.



Submit a Comment