1899 Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt
So nett
Ein Plädoyer für mehr Spielpoesie
Im Fußball wird ja heutzutage gerne und viel von „Spielkultur“ und „Spielphilosophie“ gesprochen – und die Frage ist berechtigt: Warum?
„Kultur“ ist, um es mit Fontane zu sagen, „ein weites Feld“. Oder konkret nach der Lesart der Gegenwart: alles, was vom Menschen geschaffen oder gestaltet wurde[1] .Wenn also ein Sonett von Goethe ebenso Kultur ist wie ein TikTok-Dance-Clip von GirliePower0815, ein 12-Gänge-Menü dieselbe Wertigkeit hat wie Fast-Food-Nahrung ob in Alufolie oder mit Strohhalm oder ein Blogbeitrag per se zu wertschätzen ist wie ein philosophisches Traktat zum Wesen des Lebens, verliert „Kultur“ seine Funktion als Orientierungsmerkmal, ist „Kultur“ also sowohl alles als auch nichts.
Und was ist mit „Philosophie“? Ebenfalls ein Begriff, der immer schwammiger wird, und immer weniger mit „denk weise“ zu tun hat und letztlich bestenfalls nur noch „Denkweise“ bedeutet. Läge man den klassischen Begriff von „Philosophie“ zugrunde, käme „Spielphilosophie“ mehr und mehr einem Oxymoron, einem Widerspruch in sich selbst gleich.
- Wo findet sich Kants „sapere aude“ auf dem Platz, sind doch die Spieler gehalten gerade das nicht zu tun[2], sondern den Anweisungen des Trainers zu folgen?
- Wo findet sich Sokrates‘ „Ich weiß, dass ich nicht weiß“ im Spiel, ist doch die Erwartung aller, dass die Akteure zu jeder Zeit die richtigen Antworten finden müssen.[3]
- Und wäre Stadionverbot nicht wahrscheinlicher als Stammplatz für Nietzsche und sein „Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen.“[4]
Kleiner FunFact:
Ein „Oxymoron“ ist ein Oxymoron, denn der Terminus setzt sich aus ὀξύς (oxys) „scharf[sinnig]“ und μωρός (mōros) „stumpf[sinnig]“ zusammen.
Und auch im Umfeld ist wenig „Philosophie“ zu erkennen – und es wird de facto immer weniger:
- Wir, also der Akademikerfanclub 1899 Hoffenheim Rhein-Neckar Heidelberg 2007 e. V., sind zwar nur eines von vielen, dafür das beste Beispiel, denn wir sind, wie der Fußball im Allgemeinen, kaum mit Marx in Verbindung zu bringen, wobei wir uns jetzt nicht auf „Das Kapital“ beziehen, sondern auf den Schlusssatz seines (und Engels‘) Kommunistischen Manifest im Besonderen: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“[5]
- Wir fänden es auch nicht ratsam, unmittelbar nach Schlusspfiff einem Fan der unterlegenen Mannschaft auf die Losung Siddhartha Gautamas[6] hinzuweisen „Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklichsein ist der Weg.“
- Die „Ware“ Fußball käme wohl auch näher ans Wahre im Fußball, würde in Interviews und Pressekonferenzen Wittgensteins „Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen.“[7]
Doch diese Oxymora fallen heutzutage keinem mehr auf. Im Gegenteil: Sie werden zelebriert – und Wittgenstein ignoriert, mehr noch: malträtiert, denn statt zu schweigen schwelgt man hierzulande mehr und mehr in Blabla-Blähungen.
Da werden Dinge hinzuaddiert oder auseinanderdividiert, vorprogrammiert oder neukombiniert, da gibt es Rückantworten und Kurzdeklinationen, alles Mögliche – und alles unnötig, denn was ist der Unterschied zwischen „addieren“ und „hinzuaddieren“, „dividieren“ und „auseinanderdividieren“, schließlich bedeutet „addieren“ hinzufügen sowie „dividieren“ „trennen“/„auseinandermachen“? Und wie eine Antwort immer eine Reaktion auf etwas ist, also auf und/oder an etwas zurückgeht, ist eine „Deklination“ immer etwas, was etwas in seine Einzelteile zerlegt, also kurz macht.
Zuletzt hat unser Cheftrainer diesen Bereich um einen neuen Pleonasmus erweitert.
„Wir wollen eine konstante Erfolgsmaschine werden.“
Ist eine Maschine nicht etwas, was etwas konstant macht? Würde eine solche Maschine keinen Erfolg produzieren, wäre es dann überhaupt de facto eine Erfolgsmaschine?
Nun wollen wir ihm keinen Vorwurf machen, dass er nicht die sprachliche Brillanz eines Wolf Haas, Thomas Bernhard, Josef Hader oder Peter Handke und Elfriede Jelinek hat, um hier ein paar Sprachgranden aus seiner Heimat die Ehre der Erwähnung zu erweisen, die beiden Letztgenannten sind zudem auch die letzten beiden deutschsprachigen Literatur-Nobelpreisträger (Jelinek 2004, Handke 2019), sondern dies nur als ein weiteres Sprachbeispiel für die Zunahme an reziproken Relationen von Länge und Bedeutung nehmen.
„Hä?“
Wer suggerieren will, er habe etwas Bedeutsames zu sagen, konzentriert, also verdichtet nicht die Bedeutung, sondern verlängert das Wort (s. o. „hinzuaddieren“ etc.) oder schafft Wortpaare, die in sich keinen Mehrwert bieten, wie eben „konstante Erfolgsmaschine“.
Weitere Beispiele hierfür:
-
-
- echte Authentizität
- endgültiges Finale
- komplette Vollkatastrophe
- unumstößliche Gewissheit
- vollendete Tatsachen
-
Es würde nun zu weit führen – und wir wollen ja auch langsam zum Spiel kommen –, die Ursachen für den Verlust des Verständnisses von Begriffen vollumfänglich darzulegen, was gewiss auch etwas mit „Gegenwartskultur“ zu tun hat – und „fast consumption“ (inkl. „food for thought“ – auf die Verbindung von Intelligenz und Zeit hatten wir schon im ersten Spielbericht zu dieser Saison verwiesen) –, aber es sei an der Stelle auf den Umstand verwiesen, dass Männern, die sich Steroide verabreichen, die Hoden schrumpfen.
Na, geneigte/r Leser/in, haben wir wieder deine Aufmerksamkeit?
Um es allgemeingültiger zu sagen:
Wenn man es wem zu leicht macht, erwachsen einem daraus natürlich(e) Probleme.
Auf die TSG Hoffenheim bezogen, sei hier das Wort „Komfortzone“ erwähnt.
Als Schicker und dann Ilzer hier das sportliche Geschick in die Hand nahmen, wussten sie ganz genau, wie es weitergehen muss, damit es weitergeht: so nedd.
Es brauchte keine neue Spielkultur, es brauchte überhaupt eine. Denn eines war die Spielweise der TSG mit Sicherheit nicht: ein Gedicht.
Arbeiteten sie noch in der vergangenen Saison mit den Versatzteilen vor Ort, und erinnerten dabei doch sehr an Loriots …
Melusine
Kraweel! Kraweel!
Taubtrüber Ginst am Musenhain!
Trübtauber Hain am Musenginst!
Kraweel! Kraweel!
… schufen sie in der Sommerpause neue Vers-Satzteile mit einer klaren Struktur, die innerhalb des Korsetts eine gemäßigte Kreativität zulässt – exakt wie bei einem Sonett.
Ein Sonett hat einen sehr strengen formalen Aufbau:
-
- Es besteht aus vierzehn Zeilen.
- Es setzt sich zusammen aus zwei Strophen mit je vier Versen (Quartette) und zwei Strophen mit je drei Versen (Terzette).
- Das typische Versmaß in Sonetten ist der jambische Pentameter (fünf Hebungen), in klassischen Sonetten (zu Zeiten des Barock) war es der Alexandriner (jambischer Hexameter = sechs Hebungen).
- In den beiden Quartetten kommen meist umarmende Reime (abba) oder Kreuzreime (abab) zum Einsatz.
- Das Reimschema in den darauffolgenden Terzetten kann verschiedene Formen annehmen (ccd eed,cde cde, ccd dee, cde ecd.)
Auch hierfür ein unterhaltsames Beispiel – diesmal von einem der ganz Großen aus der Stadt der Gäste, wenngleich nicht gebürtig: Robert Gernhardt.
Sonette find ich sowas von beschissen,
so eng, rigide, irgendwie nicht gut;
es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen,
dass wer Sonette schreibt. Dass wer den Muthat, heute noch so’n dumpfen Scheiß zu bauen;
allein der Fakt, dass so ein Typ das tut,
kann mir in echt den ganzen Tag versauen.
Ich hab da eine Sperre. Und die Wutdarüber, dass so’n abgefuckter Kacker
mich mittels seiner Wichserein blockiert,
schafft in mir Aggressionen auf den Macker.Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert.
Ich tick es echt nicht. Und wills echt nicht wissen:
Ich find Sonette unheimlich beschissen.
Wer sich die Trainings des Teams anschaut, erkennt auch, dass der Trainer bei seiner Tagesarbeit blockweise agiert, er an Defensive und Offensive (um im Bild des Sonetts zu bleiben: die Quartette und die Terzette) getrennt voneinander feilt, und sie dann erst zum Schluss final komponiert.
Diese Strukturen sind im Spiel auch sehr klar zu erkennen, ebenso wie die Übergänge. Das mag man im Allgemeinen unter „Spielphilosophie“ verstehen, aber wie oben doch recht ausführlich (episch?) dargelegt, träfe es der Terminus „Spielpoesie“ wesentlich besser.
Statt derselben Leier gibt es jetzt unter Schicker/Ilzer eine neue Lyrik im Spiel der TSG, die ihre Poesie erkennen lässt, aber noch nicht in Gänze entfaltet hat oder halt immer wieder Brüche aufweist, auf die man sich aktuell noch keinen Reim drauf machen kann.
So nett das Spiel der TSG auch anzuschauen ist, ihm fehlt die Kraft.
So nett das Spiel der TSG auch anzuschauen ist, ihm fehlt die Wucht.
So nett das Spiel der TSG auch anzuschauen ist, ihm fehlt der Wumms.
Sonette sind eine europäische Gedichtsform, die bei aller formalen Strenge einiges an Variabilität zulässt – und Worten.
Wir haben den Ball und alle ihren Platz,
wir spielen ihn sicher nach rechts und links.
Dann geht sie los, die Rennerei, die Hatz,
der Mann kommt ran, doch der Ball verschwind’t im Nichts.Die Flanke kommt, doch weit und breit kein Mann,
der Ball zu hoch, er über den Strafraum fliegt.
So dass kein Spieler damit etwas anfangen kann,
kein Wunder, dass man ihn ins Tor nicht kriegt.Das sah natürlich schön aus und lässt hoffen,
aufs nächste Mal, und wieder ist alles offen.
Doch wieder fliegt er vorbei an Mann und Ziel.Viel zu selten wagt man dasselbe über rechts,
durch die Mitte wäre auch mal eine Chance jetz‘.
Aber’s will nicht klappen, vielleicht will man zu viel.
Ja, danke, für den Szenenapplaus, geneigte/r Leser/in, doch das ist das Problem mit deutschsprachiger Lyrik. Sie ist oft Effekthascherei. Sie beeindruckt durch handwerkliches Geschick. Und das Erste, was man als Deutsche/r schon in der Schule lernt, ist die Kontrolle – man nennt es „Analyse“ –, und für die Wertschätzung ist die Einhaltung der Vorgaben wichtiger als der Inhalt und dessen Schönheit.
Das mag auch an der Komplexität der Vorgaben liegen. Sind es vierzehn Zeilen? Sind es zwei Quartette, zwei Terzette? Ist das Reimschema korrekt und stringent? Stimmt die Anzahl der Jamben pro Zeile? Wer halt nach alledem noch Lust auf das Ding an sich?
In der Reduktion der Vorgaben könnte hingegen der Schlüssel zum Genuss der Ästhetik liegen, wobei die Vorgaben selbst noch viel strenger als bei einem Sonett sein können.
Nehmen wir dieselbe Geschichte und passen sie in einen Haiku.
Die Idee ist links.
Der schnelle Mann ist am Ball.
Und dann ist da nix.
Diese japanische Gedichtsform hat viel weniger Regeln, aber wesentlich strengere: drei Zeilen mit klar vorgegebener Silbenzahl: fünf, sieben, fünf. Mehr Regeln gibt es nicht, aber auch keinerlei Ausnahmen – und doch oder gerade dadurch entfaltet sie mehr Kraft, Wucht, Wumms.
Zugegeben, eine selbst für unsere Verhältnisse sehr lange Hinführung zum Spiel, aber es ist ja jetzt Länderspielpause, da hast du, geneigte/r Leser/in ja auch mal etwas mehr Zeit für das, was viel wichtiger ist, als die schönste Nebensache der Welt: Poesie.
- Poesie ist Schönheit.
- Poesie ist Gefühl.
- Poesie ist gut fürs Gemüt.
- Poesie kann sich auch aus bzw. nach Niederlagen entwickeln.
- Poesie nährt das Herz.
- Poesie gibt Kraft.
- Poesie schenkt Hoffnung.
Klar, kann man sich darüber ärgern, dass „unser“ Japaner wegen des gerissenen Kreuzbands in einem Tokioter Krankenhaus liegt, während der der Gäste uns erst mit seinem vorzeitigen Sonntagsschuss, dann seinem Konterabschluss sowie kurz nach Wiederanpfiff mit seinem Zuspiel zum 0:3 mehrfach ins Herz traf, man kann sich aber auch daran aufrichten, weil man weiß, welches japanische Juwel wir da haben, denn mit Machida wären zumindest das 0:2 und auch das 0:3 zumindest so nicht gefallen.
Und Burger hätte dem Mittelfeld gewiss auch das Plus an Präzision gebracht, das Avdullahu gestern einfach fehlte. Aber auch das war nicht entscheidend für die Niederlage. Entscheidend war der Sonntagsschuss. Wieder war das nämlich der erste Schuss auf unser Tor und wieder war der drin. Dass der zweite Schuss auf unser Tor gleichbedeutend war mit dem 0:2, war natürlich bitter, aber wir erhoben uns immer wieder. (Unser Team kam einem fast wie ein Jambus vor: nieder, hoch. (unbetonte Silbe, betonte Silbe)) Oder wir grätschten selbst in Abwesenheit unseres jetzt verletzten Abwehrchefs in bester Machida-Manier Bälle von der Torlinie, die man eigentlich nicht mehr weggrätschen konnte. Hranac mit Sensationsklärung.
Und dann sogar das 1:2. Es fiel vor der Pause, aber leider bereits dem Schwenkarm des Linienrichters zum Opfer, was der VAR bedauerlicherweise bestätigte.
Nach der Pause dann das 0:3, obwohl wir auch da wieder gut bis bestens im Spiel waren. Aber so nett sich unser Spiel auch an(sehen) ließ, es mangelte ihm an Kraft, Wucht, Wumms. Wir waren einfach viel zu selten im Strafraum oder in für die Gäste gefährlicher Nähe des ihren, so dass sich eine Chance für uns hätte ergeben können.
Als wir dann mal eine hatten, nutzten wir diese sogar. In der Nachspielzeit zog Prömel mit Kraft aus gut 20 Metern mit Wucht ab – und WUMMS der Anschlusstreffer –, verzog dann aber rund eine Minute später per Kopf auf rund fünf Metern. Da dann ein 2:3 … und dann? Wer weiß ?? 3:3???
So nett lief’s dann doch nicht. Aber da war schon viel Schönes, wenngleich noch zu wenig Poetisches bei, aber das kann und das wird auch kommen. Nur wann, das wissen wir nicht.
Wir wissen nur, dass es bei dem Wunsch nach der „konstanten Erfolgsmaschine“ vorerst wird bleiben müssen. Aber jetzt ist ja Länderspielpause – und da ist ja etwas Zeit fürs Feintuning, wobei ja schon mal zumindest das Schwungrad aus den Niederlanden wieder einsetzbar sein dürfte, wenn wir in der Alten Försterei zu neuen Glanzleistungen antreten werden.
Wir plädieren für eh für
Permanent Poetry Power!
Dörfer wissen, in Metropolen
ist immer etwas mehr zu holen.
Und nicht jeder Schatz
liegt in einer Truhe
Daher harren wir in aller Ruhe
Und heben ihn auf dem Platz.
Ob’s so kommt, wissen wir natürlich nicht.
Aber wenn – es wär ein Gedicht.
Oder um es in einem Haiku zu sagen:
Die Ferne ist nah.
Kleiner Wald in großer Stadt
Sorry, Köpenick.
[1] https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-kunst-und-kultur/was-versteht-man-unter-kultur
[2] „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung“ (vgl. https://www.poesis.at/insight/sapere-aude-habe-mut-dich-deines-eigenen-verstandes-zu-bedienen)
[3] Dieser Satz geht zurück auf „Allein dieser doch meint zu wissen, da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen.“, was zu der falschen Übersetzung folgte „Ich weiß, dass ich nichtS weiß.“ (s. https://www.die-inkognito-philosophin.de/blog/ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss)
[4] https://www.projekt-gutenberg.org/nietzsch/menschli/mensch09.htmlNietzsche
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Manifest_der_Kommunistischen_Partei
[6] später: Buddha
[7] https://rundschau-hd.de/2021/03/ludwig-wittgenstein-tractatus-logico-philosophicus-wovon-man-nicht-sprechen-kann-darueber-muss-man-schweigen-wovon-man-nicht-sprechen-kann-darueber-muss-man-schweigen/


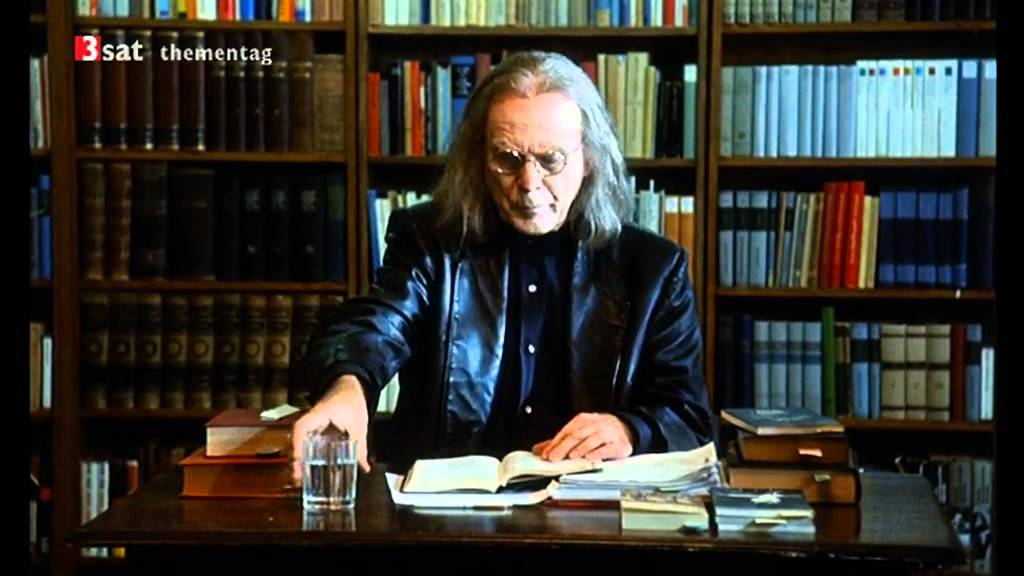

Submit a Comment